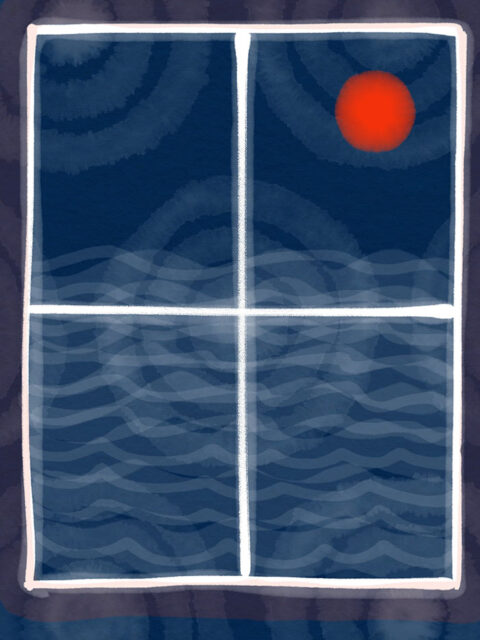
Cherchez la Femme (09/2022)
Das Wohnen, unsere Höhle. Betoniert oder frei beweglich, als Nomad:innen. Heute ziehen wir wieder unser Haus hinter uns her. Als Zelt hinterm Rad. Als Tinyhaus mit dem LKW oder als Campingbus, hässliche Plastikboxen, die massenweise über die Autobahnen im Sommer rollen. Das Feuer wurde zum unerlässlichen Induktionsherd und der braune Bär wartet möglicherweise in Tirol auf seinen Abschuss, während der Pinscher als Haustier hinter der Türe kläfft. Oder der Schäferhund. Brrr, der Wald ist dunkel und feucht. Die Ratten kommen überall hin. Ebenso die Kakerlaken. Ekelhafte Viecher. Wohnen kann armselig und dreckig sein. Es ist dann kein Wohnen, es ist pures Überleben. Wohnen kann so unfassbar schön sein wie in unseren Träumen nur. Wohnen geht auch ausgesprochen gut auf Schiffen, also eigentlich Luxusjachten. In den 1970er-Jahren in Dubrovnik wurde ich mit meinen Eltern auf so eine Jacht eingeladen. Ich kannte nur kleinere Sportboote, durchschnittliche Segeljachten, aber was ich da sah – mit Personal, mit Salon in Samt – zauberte aus mir zwar ein «Ah», aber mehr war’s dann doch auch wieder nicht. Die Kategorie Klasse entstand erst später im Erwachsenenalter. Ich bin sie bis heute nicht los. Weil ich in mehreren Stadien meines Lebens Einblick erhielt in Leben und Luxus, in das, was möglich, und das, was nicht möglich ist auf der Welt. Das erschüttert mich heute noch. Ich war damals in der Pubertät und das einzige was ich wollte, war gut auszusehen im Bikini und vom Dach der Jacht einen eleganten Sprung ins Nass zu vollführen. Das fand ich geil. Das ist heute kaum anders. Ich springe zwar nicht mehr von den Jachten der Superreichen, sondern vom Felsen einer Insel zum Beispiel, aber geil finde ich das mit oder ohne Jacht. Das Wasser, die Elemente faszinierten mich immer schon, ich brauche den intensiven Kontakt mit ihnen, um mich glücklich zu fühlen. Eine Wohnung am, im oder auf dem Wasser wäre also das Optimum, für mich. Ich brauche aber wenige Benimmregeln, High-End-Socializing, womöglich Dresscodes, eine unerträgliche High Society und 24-Stunden-Instagram-Posts vom Glücklich-Sein, mit Filter. Das ist meine persönliche Rechtfertigung für mein Non-Upper-Class-Dasein, für diesen Zwischenzustand, in den ich hineingeboren wurde, in dem ich mich ein Leben lang befand, mit einem Fuß in der Bourgeoisie, mit dem anderen Fuß dagegen tretend.
Ich glaube, dass in Österreich die Blut-und-Boden-Mentalität offen oder hinter vorgehaltener Hand noch ordentlich greift. Es ist scheinbar doch bezeichnend für eine Klasse, in der man sich bewegt, wenn die:der Nachbar:in ein wenig mehr hat und das den Neid erregt. Wenn aber einer Mateschitz heißt, dann entsteht falscher Respekt, «der muss ja was Tolles sein», weil er so viel Geld hat, weil er natürlich an Macht gewinnt, der Mateschitz, beziehungsweise die Macht ihn mit Geld ausstattet. Ich glaube, dass Reichtum beneidet wird, das sieht man an Instagram, wie junge Leute – und nicht nur diese – mit allen Mitteln versuchen, luxuriösen Lifestyle zu imitieren, um ihren Selbstwert aufzublasen. Instagram ist eine riesige Imitations-Maschinerie. Jede:r kopiert jede:n, der einen bestimmten Luxus verkörpert. Luxus und Geld kann auch zu Abwertung führen, das bekam ich bei der reichen Lady mit einem berühmten Namen zu spüren. Sie residierte in Manhattan, East Side, Central Park. Eiseskälte. Keine Gefühle. Nichts. Nur Geld Geld Geld. Es war mein kleiner Albtraum in New York. Ich schreibe darüber zum ersten Mal. Ich war sehr jung, naiv, versuchte mit ihr zu reden, Kontakt aufzubauen. Ich wohnte kurzfristig bei ihr. Ich bezahlte (!) für eine Schlafgelegenheit auf der Couch ihres Wohnzimmers. Kein Zimmer! Das war mein Wohnen in Manhattan. Ich war für sie nur Dreck. Das war eines meiner vielen Erlebnisse, die mich bestärkten, mir die Möglichkeit zu bewahren – und es war eher eine Einstellung –, mit jeder Person dieser Welt reden zu wollen, egal ob Obdachlose:r oder Tussi in Chanel oder die:der Banker:in, die:der gerade jemanden übers Ohr haut. Ich finde alle künstlich und strukturell fabrizierten «Level» oder Klassen beachtenswert, denn Raum an und für sich ist stark umkämpft und Raum-Größe entspricht oft der Dichte des Geldbeutels. Erst recht in New York, wo viele Menschen eher Bestien gleichen. Sie können nicht mehr mitempfinden, spalten ihre Gefühle ab und werden zu Kommandant:innen ihres Geldes. Müssen wir nicht leben, ja reden können, mit allen? Das ist und war stets mein Grundgerüst.
Licht und Aussicht
Mitbewohner:innen, Strukturen, Materialien, Lage, Lichteinfall beeinflussen das Wohnen maßgeblich. Laut Richtlinien des österreichischen Instituts für Bautechnik muss die lichte Raumhöhe mindestens 2,10 m betragen. Weiter lese ich, dass bei Aufenthaltsräumen die gesamte Lichteintrittsfläche mindestens 12 % der Bodenfläche dieses Raumes betragen muss. Interessante Informationen, auf die ich da stoße, ist doch meine 35 m2 große Gemeindewohnung mit kleinen Mansardenfenstern ausgestattet, bei einer Parapethöhe von 124 cm leicht über dem Wert. Aber das spielt so gar keine Rolle in meinem Wohnen, weil die Aussicht, die ich genieße, unfassbar ist. Wohnen samt der dazugehörigen Architektur ist Ausdruck einer bestimmten Zeit. Dafür sprechen die Wiener Gemeindebauten, die einzigartig sind, ebenso das internationale Renommee der Seestadt, dem Stadtentwicklungsprojekt Wiens.
Es geht nicht ins Blaue über
Ich lerne Gabi kennen. Sie wohnt in LiSA, einem der ersten integrativen Bauprojekte in der Seestadt. LiSA wurde klug konzipiert. «Es ist ein Haus mit Pawlatschen, man geht vorbei an den anderen Wohnungen, glotzt aber nicht mehr rein», sagt Gabi, «das interessiert mittlerweile niemanden mehr.» Gabi und ich lachen. Die gleichbleibende Abfolge von Wohn-Modulen und eine ausgeklügelte Anordnung der Haustechnik in Schächten ermöglichte das Festlegen verschiedener Wohnungsgrößen. 62 Menschen wohnen in diesem Haus. Der drei Meter breite Laubengang beschattet die Wohnungen und bietet Platz für Begegnungen und sozialen Austausch. Etwas, das mich brennend interessiert. Warum? Weil mit dem Älterwerden weniger möglich wird, weniger Aufwand möglich ist, zum Beispiel um gute Kontakte zu pflegen. Die Wohnungen sind durch große bodentiefe Glas-Schiebe- und Drehtüren von den Laubengängen getrennt. Weiters gibt es eine Senior:innen-WG, Sauna, Band-Probenraum und eine Gästewohnung, die derzeit ukrainischen Flüchtlingen zur Verfügung gestellt wird. Diese Gästewohnung wird von den Mieter:innen mitgetragen. Eine sogenannte Steuerungsgruppe entscheidet über die Inhalte beim Plenum. LiSA wurde als Wohnheim errichtet. Unterstützung erhielt man durch einen Projektsteuerer. Der Verein hat das Grundstück gekauft, die Organisation verläuft basisdemokratisch. Mittlerweile wurde die rechtliche Situation zur Etablierung von Wohnheimen geändert. Man hat eine Verdienstobergrenze eingeführt. Die Menschen in der Seestadt sind bunt gemischt, erzählt Gabi, es wird ein solidarisches Miteinander gelebt und zum Glück geht es nicht ins «Blaue» über! Wir lachen wieder. Erleichtert. Was sich Gabi wünscht in der Seestadt, frage ich sie. Gabi antwortet: ein orientalisches Lebensmittelgeschäft. Ich bin sicher, sie wäre nicht die einzige, die dort einkaufen würde. Was bei all den Gesprächen leicht durchscheint, ist der Wunsch, diese neue, autoberuhigte See-Stadt, mit konzipiert breiten Wegen und viel Raum, sehr viel Raum, und dem zentralen Wasser – dass diese Stadt keine Satellitenstadt wird. Es fehlt wohl doch an Cafés, an Kulinarik, an Treffpunkten, die wir auch sonst im «alten» Wien so gerne selbstverständlich aufsuchen. Wohnen ist Rückzug und Öffnung, denn zu jeder Behausung gehören Türen, zum Begrüßen, Einlassen, Rauswerfen, Abschied nehmen. Unser Raum hat also große Bandbreite an Bedeutung und Nutzen. Heute kann es passieren, dass wir uns zu sehr auf uns selbst konzentrieren und zu wenig auf ein gesundes Miteinander. Wir verlieren uns auch viel zu selbstverständlich in den Räumen des Internet. Raum, space auf Englisch, ist mehrdeutig und prinzipiell unendlich. Er muss allen zustehen. Daher ist es notwendig zeitgemäßes Wohnen zu reformieren. Um mehr Raum kämpften seit jeher auch schon Feministinnen – mit gutem Grund. Wurde vieles doch klein gehalten, klein gemacht oder durch die Gesellschaft klein vorgegeben. Sich Raum zu nehmen, kann sich auf verschiedene Arten ausdrücken, zum Beispiel durch die Dynamik der Stimme, durch eine freie Körpersprache, durch bequeme Kleidung, durch meine eigene Arbeitswohnung, durch Mitgestaltung jenes Raumes, in dem ich einen Großteil meines Lebens verbringe, und letzten Endes durch den relativ kleinen aber milliardenfach vernetzten neuronalen Raum meines Denkens und meiner Vorstellungskraft.
Diesen Raum brauchen wir jetzt alle, glaube ich, recht dringend.
